Georg Zundel über die Kriegsjahre und das Kriegsende
Auszug aus der Autobiographie GEORG ZUNDEL "Es muss viel geschehen!" 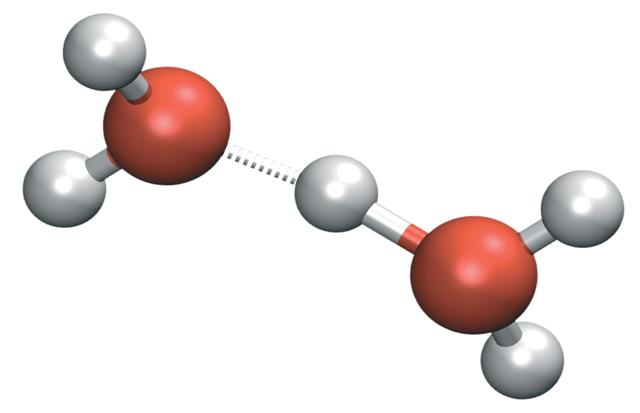
Die Kriegsjahre
1939 verließ mich meine Kinderschwester Julie Lemberger, um ihre über neunzigjährige Mutter zu pflegen. Von jetzt an begleitete sie unsere Familie nur noch in den Ferien.
In der dritten Klasse übersiedelten wir aus dem alten Schulgebäude bei der Kirche in die Dorfackerschule. Dort hatten wir einen sehr jähzornigen Lehrer, Herrn Häcker. In seinem Affekt schlug er uns Kinder brutal. Einmal zog er meinen Vordersitzer Fritz Schaal, einen schmächtigen Jungen, aus der Bank heraus und schlug mit aller Kraft auf den auf dem Boden Liegenden ein. Als das Fritzle wieder auf den Beinen stand, rieb es sein lädiertes Körperteil und sagte: „Ich sag’s meiner Mama”. Auch Herr Häcker war nie ohne Parteiabzeichen zu sehen. Nach 1945 wurde er nicht mehr in den Schuldienst aufgenommen. Er arbeitete in der Frottierweberei als Packer.
Im Sommer beneidete ich die Dorfkinder, die oft schulfrei bekamen, um auf dem Feld mitzuarbeiten. Ich war sehr beglückt, als mein Vater mir an einem herrlichen Sommertag erlaubte, auch zu Hause zu bleiben, um bei der Heuernte in unserem Obstgarten zu helfen.
Ferien machten wir mehrmals in Wildbad im Schwarzwald, denn mein Vater nahm dort Bäder. Wir wohnten oberhalb im Sommerberghotel, das durch eine seilgezogene Bahn mit dem Ort verbunden war. Schwester Julie und ihre Nichte Gerhild Schaible waren auch mit von der Partie. Wir unternahmen weite Wanderungen durch den schönen Wald, so z.B. zum Wildsee. Wir sammelten Heidelbeeren und Himbeeren. Ich übte im Wald Flöte, dies wohl zum Entsetzen der Rehlein, sofern diese musikalisch waren.
Der Krieg verlief für Hitler zunächst erfolgreich. Er eroberte Polen, dann große Teile Frankreichs und daraufhin den Balkan. Ich erinnere mich an die Sondermeldungen über die Siege im Rundfunk. Ich saß vor dem Atelier auf einem Baum und pflückte Äpfel, Französische Goldrenetten, als die Sondermeldung über die Eroberung des Isthmus von Korinth durch Fallschirmjäger durch den Äther zu mir vordrang.
Meiner Mutter habe ich nach Bad Wörishofen folgenden Brief geschrieben, der zeigt, wie es damals auf dem Berghof zuging:
Berghof, 6.7.1940
Liebe Mama!
Heute habe ich schon viel erlebt. Zuerst war ich in der Schule. Nach dem Ausruhen beim Zahnarzt, und zuletzt noch mit Papa auf dem Feld. Wir haben den Mais, Rüben, Kartoffeln, Ackerbohnen, Weizen und zuletzt den Mohn besichtigt. Wir sind mit unserer Besichtigung zufrieden. Morgen Mittag fahren wir nach Sillenbuch und holen die Kirschen u.s.w. Ich danke Dir für die lustige Karte mit dem Oberguß. Auch herzlichen Dank für Fräulein Fischers Karte! Julie war heute den ganzen Tag in den Erbsen und Frieda kochte sie ein. Papa hält die Damen in strenger Zucht, was ihnen und uns gut tut. Ich freue mich sehr, bis Du wiederkommst. Jetzt aber Schluss, ich muss zu den Hennen und zu meinen Herren Göggeln.
Von allen viele herzliche Grüße,
besonders aber von Deinem
Jörg*
*) In Tübingen wurde ich Jörg genannt.
Mein Taschengeld verdiente ich mir in dieser Zeit mit Mäusejagd. Ich hatte über den ganzen Berghof verteilt etwa zwei Dutzend Fallen. Die toten Mäuse hatten recht unterschiedliche Preise. Die billigsten waren die Getreidespeichermäuse, die teuersten die Speisekammermäuse.
Im Sommer 1940 reisten wir nach Berchtesgaden. Ich bekam dort Solbäder. Die Gletschermühlen, die ich mit Schwester Julie besuchte, beeindruckten mich sehr. Wir machten viele Wanderungen, z.B. in die Schönau. Anlässlich der Eröffnung eines großen Hotels habe ich Hitler gesehen. Mit hochgeschlagenem Kragen verließ er im Gedränge das neue Hotel. Dieses steht heute noch. Damals herrschte in Berchtesgaden rege Bautätigkeit, denn Hitler bereitete alles darauf vor, um seine besiegten Feinde zu empfangen. So wurde hierzu extra ein Bahnhof errichtet. Im darauffolgenden Jahr ließen wir uns ein Fässchen Salzsole schicken und ich nahm die Solbäder in Haisterkirch.
In den harten, schneereichen Kriegswintern war die Pfrondorfer Straße, die zum Berghof hinaufführt, eine rasante Rodelbahn. Viele Kinder kamen auch von weit her, um diese Wintersporteinrichtung zu genießen. Nur alle paar Stunden störte ein Auto.
Häufig gab es nachts Fliegeralarm. Wir verbrachten viele Stunden im Keller des Berghofs. Wenn Nachtalarm war, hatten wir erst um 9:30 Uhr Unterricht. Einmal waren wir in Sillenbuch gewesen und kehrten nur kurz vorher auf den Berghof zurück. Meine Mutter schickte mich trotzdem ohne Entschuldigung los. Ich bin selten so gerannt, denn ich malte mir dabei die schmerzhaften Folgen aus für den Fall, dass ich zu spät käme. Das Herz schlug mir bis zum Hals, aber es gelang mir gerade noch, bevor der Lehrer eintrat, das Klassenzimmer zu erreichen.
Zu dieser Zeit bekam ich den ersten Heiratsantrag. Als wir nach der großen Pause auf der Freitreppe des Schulhofs warteten, um in unsere Klassenzimmer zu gehen, sagte ein Mädchen zu mir: „Du bist ein Held. Wenn wir groß sind, heirate ich Dich.“ Was das Gertrudle dazu bewog, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich hatte ich sie in der Pause vor irgendwelchen groben Mitschülern beschützt.
Hiebe gab es auch in der Dorfackerschule schon für Kleinigkeiten. In der vierten Klasse musste beim Lesen stets einer vorlesen. Unser Lehrer saß auf dem Pult und rief immer wieder einen anderen auf, der weiterlesen musste. Wehe, wenn er dies nicht gleich konnte. Dies passierte meinem Nebensitzer Hermann Walker. Unser Lehrer stürzte sich auf ihn, streckte ihm die Hände aus und versetzte ihm – direkt an meiner Nasenspitze vorbei – zwei kräftige Tatzen auf die Handteller. In der vierten Klasse kann ich mir keinen Schultag denken, an dem der Rohrstock nicht in Aktion trat.
Im Mai 1941 erfuhr man in den Mittagsnachrichten, dass Rudolf Heß, einer der engsten Vertrauten von Hitler, nach England geflogen und dort abgesprungen sei. Hitler hatte ihn nach Göring zu seinem zweiten Nachfolger bestimmt. Nachmittags ging ich mit meinem Vater auf das Pfrondorfer Feld, um diese Neuigkeit unseren Arbeitern mitzuteilen, die dort Mohn hackten und vereinzelten. So weit ich weiß, ist es bis heute nicht geklärt, ob dies ein Alleingang von Heß war, oder ob er im Auftrag Hitlers flog. Letzteres wäre denkbar, da sich Hitler eventuell für seinen Angriff auf Russland den Rücken frei halten wollte. Doch Heß hat dieses Geheimnis mit ins Grab genommen. Er wurde beim Nürnberger Prozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit 1966 war er der letzte Gefangene in Berlin-Spandau.
Ich stand mit meinen Eltern in der Zufahrt zum Berghof beim Hühnerstall. Irgend jemand erzählte meinen Eltern von den Euthanasiemorden der Nazis in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb. Die geistig Behinderten wurden mit Bussen, deren Fenster mit schwarzen Tüchern verhängt waren, zu ihrer Ermordung herbeigeschafft, wurden entkleidet, bekamen eine Phenolspritze und wurden noch lebend in die Grube zu den Sterbenden und Toten geworfen. Ich weiß noch, wie mir bei dieser Schilderung plötzlich schlecht wurde, ich konnte nicht mehr stehen. Es war, als ob man mir die Füße wegziehen würde. Ich wollte weglaufen. Auf dem Sofa im Atelier meines Vaters kam ich wieder zu Bewusstsein.
1942 wechselte ich von der Lustnauer Dorfackerschule in das Uhland-Gymnasium. Unser Rektor in der Dorfackerschule, Herr Schumm, war sehr erstaunt, als ich mich für die Aufnahmeprüfung zum Gymnasium meldete. Offenbar waren alle Lustnauer Schüler bisher in die Kepler-Oberschule gegangen. Das Gymnasium passte jedoch besser zur Atmosphäre des Berghofs, denn mein Vater beschäftigte sich im Zusammenhang mit seiner Kunst sehr viel mit der Antike. Weniger gut passte dies jedoch zu meinen Anlagen, denn ich war hauptsächlich naturwissenschaftlich begabt. In dieser Zeit las ich mit großem Interesse „Die Höhlenkinder im Heimlichen Grund“ von A. Th. Sonnleitner, „Die Mammutjäger im Lohnetal“ von Professsor Weinreich und „Die Langerudkinder“ von Marie Hamsun, der Frau von Knut Hamsun.
Bei der Aufnahmeprüfung in das Uhland-Gymnasium saß ich neben einem Schüler, der ebenfalls keinen Mitschüler kannte. Die anderen Schüler waren ja aus Tübingen und kannten sich von der Grundschule. Der Name meines Nebensitzers war Christoph Plag. Er stammte aus einer Pfarrfamilie, die in Reutlingen in der Gustav-Werner-Straße lebte. Zwischen uns entstand eine lebenslange Freundschaft. Christoph lebt heute im Pauline-Krone-Altersheim am Philosophenweg in Tübingen. Leider ist er an Muskelschwund erkrankt.
In der Schule tat ich mich mit Latein sehr schwer, denn ich hatte zu Hause niemand, der mir helfen konnte. Mit Mühe erlernte ich die Deklinationen und Konjugationen, das Ganze sagte mir sehr wenig zu. Der Aufwand erschien mir für das zu Erreichende zu groß. Dieser Meinung bin ich heute noch. Warum man sich bevorzugt mit den militaristischen Römern befasst, kann ich nur unter dem Gesichtspunkt verstehen, dass in der Bourgeoisie der Militarismus stark verankert ist. Die vornehmen Römer hatten ja für ihre Kinder griechische Hauslehrer. Die großen geistigen Leistungen der Antike entwickelten sich nicht in Rom, sondern in Griechenland. Insbesondere die Gedanken von Sokrates und Platon sind Marksteine der geistigen Geschichte der Menschheit. Man sollte sich in den Schulen vielmehr mit den geistigen Inhalten und weniger mit der Sprache befassen. Diese Einsicht hatten jedoch unsere Lehrer am Gymnasium nicht. Meine naturwissenschaftlichen Interessen kamen in dieser Schule viel zu kurz.
Das Uhland-Gymnasium in Tübingen liegt am Neckar, in der Nähe des Bahnhofs. In der ersten Klasse hatten wir in dem Präzeptor Pflomm einen Herrn, der so war, wie man sich einen Präzeptor vorstellt (siehe „Feuerzangenbowle“). In jungen Jahren hatte er sicher den Schülern die lateinischen Deklinationen und Konjugationen eingeprügelt. In seinem Schrank hatte er noch eine Sammlung von Rohrstöcken. In der großen Pause wanderte ich mit meinen Freunden Christoph Plag und Joachim Hermann (Sohn des Komponisten Hugo Hermann, der an der Musikhochschule in Trossingen auf der Schwäbischen Alb tätig war) um den Anlagensee.
In den folgenden Jahren war unser Klassen- und Lateinlehrer Herr Rainer. Er war im Krieg in Russland schwer verwundet worden und hatte einen Fuß verloren. Seine Prothese gab ein knarrendes Geräusch von sich, was ihm, zusammen mit seinen Erzählungen darüber, welche Geräusche russisches Kanonenfeuer verursacht, den Spitznamen „Ratsch Bumm“ einbrachte. Leider konnte mich auch sein sehr guter Lateinunterricht nicht für die Sprache der Römer begeistern. Bei unserem Abiturienten-Treffen zum 50-jährigen Jubiläum habe ich erfahren, dass Herr Rainer – in der Zwischenzeit 92 Jahre alt – noch lebte.
Wenn ich eine Stunde früher schulfrei hatte und auf den Bus warten musste, besuchte ich stets meine frühere Kinderschwester Julie, die im Haus der Bäckerei ihres Bruders Karl in der Wilhelmstraße lebte. Als ich ihr sagte, dass ich später in Hohenheim Landwirtschaft studieren und in Sillenbuch wohnen wollte, schlug Julie vor, mir den Haushalt zu führen. Um die Sache für mich attraktiver zu machen, hat sie gemeint, ich dürfe auch nette Studentinnen mitbringen.
Im Winter 1942/43 erkrankte ich sehr schwer an der aus Russland eingeschleppten Grippe. Sie endete bei Kindern häufig tödlich. Professor Birk, der Leiter der Kinderklinik, rettete mir das Leben durch eine für damalige Verhältnisse ungewöhnlich fortschrittliche Idee. Er spritzte mir mehr als einen Liter Blutserum meines Vaters. Dieses enthielt natürlich viel mehr Antikörper als mein Blut. Darunter waren offensichtlich auch solche, die gegen diese Grippe wirkungsvoll waren. In wenigen Tagen kam ich wieder auf die Beine. Im Jahr 1943 schrieb ich folgenden Brief nach Wörishofen an meine Mutter, die dort kneippte:
Tübingen, den 2.10.1943
Liebe Mama!
Wie geht es Dir, mir geht es gut. Heute war Julie da, wir waren im Wald und fanden Steinpilze, leider kann man sie nicht nehmen, weil sie schon zu groß sind. In der Schule hatten wir gestern eine lateinische Klassenarbeit, sie war sehr schwer und auf eine andere Art. Im letzten Diktat hatte ich 3+. Im Aquarium geht alles gut, die Kaulquappen sind jetzt endgültig zu Fröschchen geworden, nämlich die Fröschchen sind kaum 1 cm groß. Der Muschel geht es auch gut. Mein Endivie im Garten schießt, dass es bloß so kracht. Die Petersilie ist schon wieder etwa 7 cm gewachsen und schön grün geworden. Die Aufnahmen vom Märchensee sind schön geworden. Meine kleinen Ablegerchen sind schön angewachsen, drunten im Garten wächst z.Z. ein Riesenkürbis heran. Es grüßt Dich das Aquarium, der Garten und hauptsächlich ich.
Dein J. Zundel
Nachsch[rift].: Heute Nacht bei Fliegeralarm kamen zwei Fledermäuse in den Keller, da erbleichte jemand.
Anmerkung: Tante Frieda hatte schreckliche Angst vor Mäusen, insbesondere vor Fledermäusen. Wenn man im Treppenhaus einen Schrei hörte, hing dort eine Fledermaus und behinderte Tante Frieda am Weiterkommen.
Aus Stuttgart – vor den Luftangriffen evakuiert – fand bei uns Horst Lemberger, ein ferner Verwandter von Schwester Julie, Aufnahme. Wir gingen in dieselbe Klasse. Leider waren unsere Anschauungen und Interessen so verschieden, dass wir nicht zusammenfanden. Wir haben uns oft schrecklich gestritten. Er war ein Stadtkind. Nach dem Krieg haben wir uns nie mehr gesehen.
Einquartiert war in dieser Zeit bei uns ein Oberstabsapotheker. Er wohnte im obersten Stock im südwestlichen Zimmer. Vor seinem Zimmer stand der Schlummerkorb meines Hundes Moritz. Eines Tages klagte unser Apotheker, er habe furchtbar viele Flöhe. Alle waren zunächst schockiert. Später kam heraus: Er hatte eine seltene Blutgruppe; die Hundeflöhe finden das Blut dieser Menschen besonders schmackhaft.
Das Eindringen von Hitlers Armeen in Russland verfolgte ich mit großem Interesse auf der Landkarte. Ich markierte mit Stecknadeln die Front.
Am Mittwochnachmittag besuchte uns während des Semesters stets Professor Bruno Niekau. Er hatte früher seine Praxis in Lustnau und war jetzt Internist am Krankenhaus in Oberesslingen. Jeden Mittwoch hielt er an der Universität in Tübingen eine Vorlesung. Meine Mutter kochte dann mit ihrer raffinierten Kona Kaffeemaschine Kaffee, den er sehr schätzte.
Es gab nun bereits häufig Fliegeralarm, das Ziel Stuttgart war nahe, und die Flieger sammelten sich zum Angriff über dem Schönbuch. Anfangs verbrachten wir die Zeit des Fliegeralarms im Keller des Berghofs. Der Schulunterricht wurde häufig durch das Heulen der Sirenen unterbrochen. Trotz akuter Luftgefahr wurden wir heimgeschickt. Wir hatten sehr gute Lehrer, unser Französisch-Lehrer, Herr Rupp, der bereits im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren hatte, war jedoch nicht der Hellste. So geschah es eines Tages, dass wir uns wohl oder übel wieder bei akuter Luftgefahr auf den Heimweg machten. Wir befanden uns gerade auf der Neckarbrücke, als drei silbern glänzende Jagdbomber vom strahlend blauen Himmel auf uns niederstießen. Herr Rupp, der sich auf dem Gehsteig befand, fuchtelte mit seiner Krücke und brüllte: „Nieder, nieder!” Das war unter diesen Umständen auf einer Brücke sicherlich nicht das Richtige. Wir traten in die Pedale. Doch die Jagdbomber hatten mit der Bevölkerung Erbarmen und zogen ohne abzuwerfen wieder hoch.
Einmal, ich schob mein Fahrrad die Staffeln bei unserem Gemüsegarten hoch, brauste in weniger als 50 Metern Höhe von Westen ein deutscher Flieger heran, hinter ihm ein französischer Jäger. Ich warf mich über mein Fahrrad. Der Franzose drückte ab. Im Gemüsegarten unmittelbar neben mir spritzte durch die Einschläge der Geschosse die Erde hoch. Dies wäre beinahe schief gegangen. Damit wäre Ihnen die vorliegende Lektüre erspart geblieben.
Wir hatten einen sehr tüchtigen Melker, Herrn Tepan. Dieser wurde, ich glaube im Jahre 1943, eingezogen und war bereits nach vierzehn Tagen tot.
Viele Jahre, auch in den Kriegsjahren, arbeitete bei uns Reinhard Kunselmann aus Pfrondorf. Er versorgte das Jungvieh und die Schweine. Als er pensioniert wurde, zahlte ihm meine Mutter eine zusätzliche Rente für die langjährige Treue zum Berghof. Der im Folgenden wiedergegebene Brief zeigt die Güte dieses sehr einfachen Menschen.
Pfrondorf, 13.8.73
Guten Morgen Frau Zundel.
Ich habe den Brief dankend erhalten. Und vernommen, dass sie mir die Rente wieder weiter geben wollen. Frau Zundel. Ich habe in letzter Zeit den Körperbehinderten 500 Geld Spende gegeben. Und später 1000 Mark für Körperbehinderte für Pfrondorf. Ich habe auch ein gutes Herz für andere. Und dem Musikverein Pfrondorf auch 1000 M. Spende gegeben. Es hat mich sehr gefreut, so lange Rente gegeben von Frau Zundel. Und jetzt habe ich Geld genug zum Spenden. Es ist ganz unnötig, die Rente mir wieder geben. Reinhart hat eine schöne Rente 600,33 Mark. Das ist doch ein schönes Geld. Ich werd auch schon 83 Jahre alt. Noch nie gedacht so lange leben. Wo immer ein bisschen krank gewesen. Und die vielen Operationen in Tübingen und dergleichen. Frau Zundel. Sie werden auch 84 Jahre. Wenn man überlebt. Und wünsche Frau Zundel gute Besserung. In diesem Alter.
Mit Gruß Kunselmann
Die Sommerferien verbrachte ich in diesen Jahren stets mit meinem Freund Bernd Niekau in Haisterkirch. Unsere Eltern waren befreundet, denn Professor Niekau hatte, wie bereits erwähnt, früher in Lustnau seine Praxis. Wir pressten Blumen, fingen Frösche und Krebse, sammelten Pilze, unternahmen ausgedehnte Radtouren und gingen ins schöne Strandbad in Waldsee schwimmen.
In einem dieser Sommer brach in Haisterkirch eine Epidemie aus, und zwar eine Darmgrippe, verbunden mit schrecklichem Durchfall. Alle außer mir waren betroffen. Flachs musste damals händisch ausgerissen werden, um auch die Wurzeln zu erhalten. Das Flachsfeld lag glücklicherweise neben dem Maisacker, der infolge der Epidemie reichlich gedüngt wurde. Wenn wir von Waldsee kamen, ersehnten alle den Wald. Dort befand sich eine Bank. Zur selben Zeit bekam die Mutter von Tante Frieda eine Geburtstagsgratulation von einem Kegelclub Excelsior. Ich nahm die Gelegenheit wahr und taufte unseren explosiven Verein „Kegelclub Explosiv”. Damit erhielt auch die Bank den Namen: „Bank des Kegelclubs Explosiv“. Leider ist diese Bank vor einigen Jahren verschwunden. Ich erinnere mich, wie an dem langen Acker an der Wendelinuskapelle das Getreide noch mit der Sense geschnitten wurde. Sechs Mäher verrichteten hintereinander diese mühsame Arbeit. Besonders unangenehm war das Einbringen der Gerste in die Scheuern, denn die Grannen juckten auf der bloßen Haut. Wenn hinten auf dem Hof unter dem Vordach gedroschen wurde, vergnügte sich eine kleine Heerschar Spatzen an der Spreu, um ihren Speiseplan zu ergänzen. Abends wurden auf dem Hof unter dem Vordach die Sensen gedengelt. Beim Schmied Neyer wurden Pferde neu beschlagen. Im Sommer dauerte es lange, bis im Dorf Ruhe einkehrte.
Im Winter stand die Dreschmaschine unter dem Vordach gegenüber dem Atelier. Die schweren Getreidesäcke trug man auf der Schulter zum Getreidespeicher über dem Maschinenschuppen. An Fronleichnam wurde unter diesem Vordach ein Altar aufgebaut. Vom Atelier kann man auch heute noch an diesem Festtag die neueste Hutmode der Haisterkircherinnen studieren.
Auf dem Hof in Haisterkirch hatten wir eine Polin, die Polen-Martha. Sie bekam eines Tages ein Kind von einem unserer französischen Kriegsgefangenen. In ihrer Notlage brachte sie ihr Kind um. Dies blieb mir nicht verborgen. Von den Erwachsenen bekam ich keine Auskunft über das Schicksal des Kindes. Dieses Geschehnis beschäftigte mich lange Zeit intensiv.
Der Unterricht im Gymnasium fand nur noch sehr sporadisch statt. In der Nacht vom 15. auf den 16. März 1944 herrschte ein Föhnsturm. Die Bomber wurden von Stuttgart abgedrängt, damit ging der Luftangriff auf uns nieder. Wir befanden uns im Keller. Ich lag zitternd auf meinem Strohsack. Meine Mutter versuchte, mich zu beruhigen. Das Pfeifen und die Detonationen der Sprengkörper waren schrecklich. Die Phosphorkanister verursachten ein nervenaufreibendes Klappern. Bei jeder Detonation bebte der Kellerboden. Als wir aus dem Keller kamen, blickte ich zum Fenster des Verbindungsgangs (Gang zwischen Wohnhaus und Atelier meines Vaters) hinaus. Über den Orten Kusterdingen und Wankheim jenseits des Neckartals stand eine riesige, durch den Wind etwas nach Osten geneigte, züngelnde Flamme. In Lustnau brannten sechs Höfe ab. Unterhalb des Berghofs waren zwei Häuser durch Sprengbomben zerstört. Ihre Bewohner haben glücklicherweise im Bierkeller überlebt. Das Uhlandhaus am Beginn der Tübinger Gartenstraße war durch eine Luftmine im wahrsten Sinne des Wortes weggeblasen worden, ebenso das Denkmal des Grafen Eberhardt im Barte auf der Neckarbrücke.
Glücklicherweise war das Gros der Spreng- und Brandbomben auf dem freien Feld niedergegangen. Die über sechzig Sprengkörper und etwa dreißigtausend Brandbomben hätten, wären sie auf bewohntes Gebiet gefallen, Furchtbares angerichtet. Eine Luftmine, die im Wald hinter der Sonnhalde explodierte, deckte bei uns alle Dächer ab und drückte viele Fenster ein, obwohl diese vorsichtshalber nicht verschlossen, sondern nur mit Federn zugehalten waren. Das Oberlicht des Ateliers meines Vaters wurde heruntergedrückt und verursachte an seinem Schreibtisch, den ich heute benutze, sichtbare Narben. Wir zählten auf einem unserer Äcker auf dem Steudach über dreißig Brandbomben.
In den nächsten Tagen bekam ich, wenn die Sirenen heulten, jedes Mal Panik und Angst. Ich sammelte im Garten Bombensplitter. Einmal fand ich im Wald nahe beim Steinbruch eine nicht gezündete Brandbombe. Von da an gingen auch wir bei Fliegeralarm in den Bierkeller. In diesem ausgedehnten Kellersystem lagerte früher die Brauerei Leicht ihr Bier. Im Dunkeln war jedoch der Weg über die Staffeln zum Bierkeller hinunter recht mühsam, zumal oft Eile geboten war. Eines Tages – wir saßen gerade beim Mittagessen – überflog uns ein Bomberverband mit großem Gebrumm. Mein Vater wollte, dass ich den Esstisch nicht verließ und hielt mich am Handgelenk fest. Ich war jedoch nicht zu halten und stürzte ins Freie. Ich sah, wie die Bomben aus den Flugzeugrümpfen in die Tiefe auf die Kasernen und den Bahnkörper stürzten. Einige Häuser in der Bismarckstraße, die am Bahnkörper entlang standen, waren zerstört worden. Ich fuhr hin und erinnere mich an eine Gruppe von Kindern, ein etwas älterer Junge sagte: „Mit denen, die hier unter den Trümmern liegen, haben wir vor einer Stunde noch gespielt.” Mein Vater hat sich nachher bei mir entschuldigt. Er sagte, er habe die Situation falsch eingeschätzt.
Als wir nach dem furchtbaren Angriff auf das über fünfzig Kilometer Luftlinie entfernte Pforzheim aus dem Bierkeller zum Berghof hinaufstiegen, sahen wir die riesigen Flammen, die über dieser Stadt in die Höhe züngelten. In dieser Nacht verbrannten in Pforzheim über vierzigtausend Menschen. Wenige Tage später erhielt mein Vater die Nachricht, dass man seine drei Stiefschwestern als eng umschlungene, verkohlte Skelette im Keller ihres Hauses gefunden habe.
In der zweiten Hälfte des Krieges arbeitete bei uns eine ukrainische Zwangsarbeiterin namens Eva. Sie kam mit ihrer einzigen Habe, einem Huhn unter dem Arm, bei uns an. Sie kochte für die Arbeiter auf dem Hof und sicher nicht schlecht, was man ihrer Figur ansah. Nach dem Krieg wurde sie, obwohl sie gerne bei uns geblieben wäre, zwangsrepatriiert, wie dies genannt wurde, was auch mein Vater nicht verhindern konnte. Ihr Huhn, das natürlich auch den Namen Eva trug, musste sie zurücklassen. Es hat bei uns nie ein Ei gelegt, dennoch durfte es noch jahrelang Gnadenkörner picken, dies bis zu seinem natürlichen Ende.
Die Sommerferien verbrachten wir in Haisterkirch. 1944 flogen täglich viele Pulks von jeweils etwa 25 silbern glitzernden Bombern nach München, um zwei Stunden später nach erfolgtem Vernichtungswerk zurückzukehren. Die Bomber flogen ohne Schutz durch Jagdflugzeuge völlig unbehelligt. Aus meiner heutigen Sicht waren diese Terrorangriffe gegen die schutzlose Zivilbevölkerung ein völkerrechtswidriges Kriegsverbrechen, das nach dem Krieg hätte gesühnt werden müssen. Die aufkommende Aggression der Amerikaner gegen die Russen führte zu dem entsetzlichen Bombardement von Dresden, in dem sich hunderttausende Flüchtlinge aus den Ostgebieten aufhielten. Ich vermute, dass die westlichen Alliierten Dresden nicht unzerstört den Russen überlassen wollten und deshalb den Tod der Bevölkerung und der Flüchtlinge in Kauf nahmen.
Die Veranstaltungen des Jungvolks habe ich nur unregelmäßig besucht. Ich erinnere mich an einige spannende Geländespiele. Im Herbst 1944 kam ich in die Hitlerjugend, und zwar in die Nachrichten-Abteilung. Was wir dort lernten, unter anderem Funken, sprach mich sehr an. Die Ausbildung erfolgte durch zwei Obergefreite, die uns – insbesondere im Gelände – sehr rüde behandelten. Wegen Kleinigkeiten ließen sie uns auf allen Vieren durchs Gelände robben. Diese Ausbildung wurde natürlich im Hinblick auf eine spätere Verwendung beim Militär durchgeführt. Aber soweit kam es Gott sei Dank nicht mehr, denn die Fronten rückten von allen Seiten näher.
Bereits im Januar wurde Aachen von den Alliierten besetzt. Einmal hatten wir eine Hitlerjugendveranstaltung im Pfleghofsaal. Es gab Luftalarm, akute Luftgefahr. Darauf marschierten alle singend zum Schloss, um dort im Schlosskeller die Veranstaltung fortzuführen. Ich setzte mich mit einigen anderen ab. Wir fanden im Luftschutzkeller in der Brunnenstraße Zuflucht. Am nächsten Tag wurde ich von einem meiner Mitschüler, Tulo Müller – sein Vater war Arzt im Tropengenesungsheim – in der Schule darauf angesprochen, dass wir desertiert seien. Tulo Müller war in Deutsch-Ostafrika geboren. Alle Auslandsdeutschen waren besonders national.
Unser Gärtner, Hermann Schmied, war den ganzen Krieg u.k. gestellt (vom Wehrdienst zurückgestellt), da wir in großem Umfang Obstbau und für die Ernährung wichtigen Feldgemüseanbau betrieben. Er hatte vier Kinder, die Älteste, Ilse, war Patenkind meines Vaters. Diese u.k.-Stellung hat Hermann Schmied meinem Vater sehr übel genommen, denn er fühlte sich den anderen Männern gegenüber, die eingezogen wurden, zurückgesetzt. Im Januar 1945 wurde er zum Schanzen an den Westwall geholt. Er bekam Typhus und war bereits nach drei Tagen tot. Die große Anzahl von Obstbäumen musste dennoch geschnitten werden. So kam es, dass mich mein Vater hierzu anlernte. Den ganzen Februar und März habe ich mit ihm unermüdlich Bäume geschnitten. Von der Erlernung dieser Kunst profitiere ich heute noch.
Auf unserem Hof in Tübingen arbeiteten sehr tüchtige französische Kriegsgefangene. Zweien von ihnen gelang die Flucht in ihre Heimat. Ein besonders gutes Verhältnis hatten wir zu einem Bretonen. Als das Kriegsende nahte, zeigte er meinem Vater, dass er für uns im Obsthaus hinter den Kisten Getreide versteckt hatte, dies vor seinen eigenen Landsleuten! Einmal musste ich in Hitlerjugenduniform mit Hakenkreuzarmbinde an unseren französischen Kriegsgefangenen vorbei, die im Garten arbeiteten. Ich empfand dies als sehr peinlich.
Im Februar 1945 bekamen wir Besuch aller Bosch-Direktoren. Sie wollten sich offenbar unserer Solidarität vergewissern. Es ging um das Verhältnis der Firma zum NS-Regime. Mein Großvater hatte Carl Goerdeler unterstützt, einen der führenden Vertreter des konservativen Widerstands gegen Hitler. Goerdeler war am 2. Februar 1945 hingerichtet worden. Wir begleiteten die Direktoren zum Lustnauer Bahnhof. Die kleine Heerschar schwarzbefrackter Herren sah aus wie eine Schar Pinguine. Als Hitlerjunge wurde ich noch im März 1945 in der Aula der Universität Tübingen feierlich auf Hitler vereidigt. Mit erhobenem rechtem Arm mussten wir Hitler ewige Treue schwören. Meine Eltern wollten sehen, was man mit mir vorhatte und wohnten deshalb auf dem Balkon der Aula dieser Zeremonie bei.
Kurz darauf übersiedelten wir nach Haisterkirch. Als ich eines Tages mit meinem Vater in Graben (Weiler auf dem Höhenzug über Haisterkirch) war, mussten wir uns vor einem Tiefflieger in den glücklicherweise nahen Wald retten. Diese Tiefflieger hießen Marauder. Wir rannten Richtung Wald. Mein Vater, damals fast siebzig, konnte nicht so schnell. Er bedeutete mir, ich solle vorausrennen, was ich jedoch in keinem Fall wollte. Der Tiefflieger musste, um uns wieder ins Visier zu bekommen, eine Schleife fliegen. Dabei verlor er uns aus dem Gesichtsfeld. Wir erreichten den Wald. Seine Salve zerfetzte wenig neben uns die Bäume. Es war sehr schlimm, wie die Bauern bei der Frühjahrsbestellung durch die Tiefflieger gefährdet wurden. Die Feldbestellung konnte nur nachts durchgeführt werden.
Ich arbeitete gerade im Stall, als unser Tübinger Fähnleinführer in Haisterkirch vorbeikam. Er lobte mich, dass ich für das Vaterland wichtige Dienste leiste. Er war auf der Flucht Richtung Gebirge. Er stellte bei uns umfangreiches Gepäck ab, das wir in der Garage aufbewahrten. Als wir dieses viel später öffneten, sahen wir, dass es viele Uniformen mit Hakenkreuzbinden enthielt. Lange Zeit hatten die Franzosen, davon nichts ahnend, in dieser Garage ihre Werkstatt. Meine Hitlerjugenduniform brachten wir in das Dickicht im Wald rechts vom Weg zur Sebastianskapelle. Das Paket war bereits nach wenigen Tagen verschwunden.
Das Kriegsende
Drei Tage lang drängten sich die Kolonnen der fliehenden Schwarzwaldarmee über die Straßen des Oberlands und auch durch Haisterkirch nach Osten. Unter diesen Kolonnen befand sich auch ein Trupp KZ-Häftlinge. Einige brachen am Haisterkircher Berg zusammen, zwei wurden erschossen. Ein ungarischer Weinkaufmann konnte fliehen und wurde von einer Familie in Ehrensberg (kleiner Weiler bei Haisterkirch) versteckt. Zum Dank dafür sandte er nach dem Krieg an diese Familie jedes Jahr zu Weihnachten eine Kiste Wein. Die zwei Ermordeten wurden später auf den Friedhof überführt. Die Dorfbewohner mussten an den Aufgebahrten vorbeidefilieren.
Unser Verwalter in Haisterkirch, Karl Kettenacker, war ein Feldwebeltyp. In der Tat war er im Ersten Weltkrieg Feldwebel gewesen. Aus Zorn hatte er einmal einen unserer französischen Kriegsgefangenen, Moritz, geohrfeigt. Die anrückenden Franzosen versetzten ihn deshalb in Panik. Als die sich zurückziehenden Deutschen unsere vier Paar Pferde mitgenommen hatten, die ja damals für den Hof lebensnotwendig waren, getraute er sich nicht, sie zurückzuholen. So musste es mein Vater selbst versuchen. Er kam bald mit den Pferden zurück, denn diese waren nur als Vorspann am Haidgauer Berg benötigt worden.
Moritz verhielt sich völlig loyal. Es hatte ihm offenbar trotz allem bei uns gut gefallen. Nach dem Krieg kam er mehrmals und zeltete in unserem Obstgarten mit seiner von Jahr zu Jahr wachsenden Familie. Die letzte Tat unserer französischen Gefangenen war es, dass sie für uns zwischen Haus und Atelier ein Stück Wiese als Gemüseland umgruben.
Mein Vater machte sich große Sorgen, dass der Berghof zerstört werden könnte, wenn um das Neckartal gekämpft würde. Ich stieg mit ihm auf die Höhe über Haisterkirch. An den Bränden sah man die von Westen herannahende Front. Einige Tage später zog ich mich gerade morgens im Atelier meines Vaters an, als im Garten unseres Nachbarn Maierhofer eine Granate einschlug. Ein Granatsplitter zertrümmerte die Fensterscheibe, hinter der ich stand.
Bei uns im Haus wohnte die Frau eines Oberstabsapothekers, Frau Hielscher. Diese hatte Unmengen von ihrem Mann in Frankreich gestohlenen Cognac. Um Unheil zu verhüten, verstauten wir diesen in der hofeigenen Brunnenstube. Zwei Kisten Wein meines Vaters vergruben wir im Wald bei der Holzwiese. Wir hatten einen originellen Bauunternehmer, Herrn Krattenmacher. Er sagte zu meinem Vater, sein Rauchfleisch habe er unter dem Blumenbeet vergraben und Vergissmeinnicht darauf gepflanzt.
Wenig später herrschte morgens im Ort große Aufregung. Französische Panzer standen auf der von Bad Waldsee kommenden Straße oben am Wald vor einer Straßensperre, die die abziehenden deutschen Truppen errichtet hatten. Die Franzosen drohten mit dem Beschuss des Dorfes. Mein Vater beseitigte mit einigen Männern dieses gefährliche Hindernis. Als die Franzosen Haisterkirch mit drei Schützenpanzern, denen vier Scharfschützen vorangingen, besetzten, standen wir vor der Haustür. Die Besatzung der Schützenpanzer grüßte freundlich. Um den Höhenzug im Osten über Haisterkirch wurde drei Tage lang gekämpft. Einmal kam ein deutscher Spähtrupp ins besetzte Dorf. Mein Vater gab den Männern Essen und Wein. Am Friedhof standen französische Geschütze, die das Nachbardorf Ziegelbach in Brand schossen. Ein französischer Panzer, der zur Erkundung in Richtung Haidgau vorgeschickt worden war, zog sich so eilends den Haidgauer Berg herunter zurück, dass er sich überschlug und kopfüber im Garten des Schmieds Neyer landete.
Maria Knöpfler, die Frau des Oberlehrers an der Haisterkircher Schule, hat die Ereignisse um das Kriegsende niedergeschrieben. Dieser Bericht ist als Anhang 1 zu finden.
Das Panzerkorps, das Haisterkirch erobert hatte, stieß gleich weiter in Richtung Alpen vor. In Sonthofen war eine Napola (Nationalpolitische Erziehungsanstalt). Die zwölf- bis sechzehnjährigen Jungen setzten den Franzosen erbitterten Widerstand entgegen. Das Panzerkorps kehrte nach etwa zehn Tagen zurück. Bei ihrer Quartiersuche stürmten die Franzosen ins Atelier meines Vaters, wo wir uns gerade aufhielten. Unter der Tür blieben sie beim Anblick des Bildes „Der Schlosser” verblüfft stehen. Ein ellenlanger Elsässer bemerkte: „Nein, hier ist kein Quartier”. Sie quartierten sich schließlich in unserem Wohnhaus ein, das Atelier blieb uns überlassen. Meine Großmutter wurde auf dem Hof untergebracht. Einer der Panzer, der unter unserem Scheunenvordach stand, war noch voll vom eingetrockneten Blut seines Kommandanten, der bei den Kämpfen in Sonthofen an einem der letzten Kriegstage gefallen war.
Ein französischer Offizier aus dem Elsaß war Volkswirtschaftler und kannte das Buch meiner Tante über „Gelenkte Marktwirtschaft”. Beide diskutierten nächtelang.
Am 8. Mai veranstalteten die Franzosen auf der Wiese südlich von unserem Haus eine große Siegesfeier mit Feuerwerk. Es folgte eine einwöchige Besetzung durch französische Maquistruppen. Diese waren ursprünglich Partisanentruppen, die vom französischen Widerstand gesteuert wurden. Sie waren sehr unzugänglich und schossen auf alles, was ihnen in den Weg kam. Meine Mutter suchte mich eines Tages verzweifelt. Sie fand mich friedlich lesend im Atelier. Die nächste Einquartierung waren Marokkaner. Wir hatten etwa 50 Soldaten mit ihren Maultieren auf dem Hof. Mein Vater versorgte sie mit Milch. Als sie abzogen – wir kamen gerade von einem Spaziergang zurück – wollte einer von ihnen meinem Vater eine Schürze voller Münzen als Bezahlung für die Milch geben. Die Marokkaner – selbst aus einem besetzten und unterdrückten Land – hatten wohl Mitgefühl mit den Deutschen, sie waren sehr deutschfreundlich. Einmal wollte mich einer zu seinem Mittagessen einladen, das er auf dem Boden neben unserem Schweinestall hockend kochte. Nach etwa vier Wochen zogen die marokkanischen Truppen wieder ab. Wir hatten zunächst keine Besatzungstruppen mehr.
Tante Frieda hatte den Berghof mutig verteidigt. Ein Franzose namens Pièrre kümmerte sich hilfreich um sie und ihre Probleme. Mein Vater hat sie später oft im Hinblick auf ihren Pièrre aufgezogen.
Die Franzosen hatten Tübingen für ihre marokkanischen Truppen drei Tage lang zum Plündern und Schänden freigegeben. Der Plünderei auf dem Berghof ist unter anderem meine Märklin-Eisenbahn zum Opfer gefallen. Else Gräter, ein sechzehnjähriges Mädchen, das bei uns Lehre machte, wollte noch nach Hause und wurde auf dem Heimweg sieben Mal von Marokkanern vergewaltigt. Über siebentausend Frauen mussten nach diesen Geschehnissen in der Universitätsklinik behandelt werden. Im Lateinischen und Griechischen tat ich mich sehr schwer, deshalb hatte ich nach dem Krieg Nachhilfeunterricht bei dem pensionierten Pfarrer Bayer, der am Denzenberg wohnte. Er war querschnittgelähmt und dadurch an den Rollstuhl gebunden. Er erzählte mir, dass in den Tagen der Plünderung ein Mädchen Tag und Nacht neben seinem Rollstuhl gekniet sei, während man vom oberen Stock Schreie eines Mädchens hörte, das von den Marokkanern gequält und vergewaltigt wurde.
Bereits am 9. Mai 1945 konnte uns Tante Frieda durch einen Franzosen einen Brief senden, der uns jedoch erst viel später erreichte. In diesem teilte sie uns mit, dass auf dem Berghof alles glimpflich abgegangen war. Sie schrieb:
Berghof, 9.5.45
Meine Lieben!
Wie glücklich war ich und wir alle gestern, als Nachricht von Euch kam. Ich versuche täglich Euch Nachricht zukommen zulassen, aber vergebens. Wir wollen sehen, ob der Brief durchkommt. Costia hat auch geschrieben. Es gab viel zu überstehen, doch blieben wir vor dem Schlimmsten bewahrt. Bei allem, was fehlt, stelle ich mich allmählich auf den Standpunkt, wäre eine Bombe ins Haus gefallen, wäre mehr kaputt.
Seit 9 Tagen haben wir die Reparaturwerkstätte vom Roten Kreuz auf dem Hof, dazu etwa 35 Mann Einquartierung. Das Haus ist von oben bis unten besetzt (Atelier ausgenommen). Ich habe täglich für 14 - 16 Offiziere und Unteroffiziere zu kochen, mit Hilfe von zwei Marokkanern, die auch servieren. Musikzimmer ist Speisezimmer, Esszimmer ist Büro, in Frieders Zimmer schläft Costia, ich im mittleren, in der Sonnhalde wohnt ein Offizier und ein Adjudant. Als weibliche Hilfe habe ich die Schwester von Frau Reuter, eine Rote Kreuz Schwester. Erna kann erst kommen, wenn das Haus leer ist. Wir leben fast von lauter Wild. Hoffentlich blieb in Haisterkirch die Wäsche erhalten. Herr Wenske hat mir und dem Hof durch seine Gewandtheit und Sprachkenntnisse gute Dienste geleistet. Auf der Bühne haben wir noch ein paar Hühner. Täglich holt das französische Rote Kreuz 80 Liter Milch für ihr Lazarett. Vom Vieh kam bis jetzt ein Stück fort. Die größte Sorge machte mir der Hof. Drei Wochen wurde außer in den Ställen nichts gearbeitet. Seit letzter Woche darf man wieder aufs Feld. Die Brücke der Umgehungsstraße sowie die Neckarbrücke wurden gesprengt, z.Zt. wird daran gearbeitet. Wir müssen halt heuer ernten was wächst. – Morgen muß ich ein Festessen kochen zur Siegesfeier. Die Mannschaftsküche ist in der Milchabgabe.
Als erstes wollte ich doch schreiben, dass die Bilder alle unversehrt blieben. Heute konnte ich einen Brief nach Sillenbuch geben, will sehen, was ich von dort höre. Fräulein Roser ist mir eine große Hilfe in den Gärten. Wir pflanzen halt, was wir können. Die Tomatensetzlinge sind unter dem Glas z.gr. Teil erfroren. Die Blüte war einzig schön, dann kam der Frost, 6° unter Null. Ich glaube nicht, dass alles erfroren ist. –
Von meinen Angehörigen werde ich wohl nichts erfahren. Wie ich hörte, ist dort amerikanische Besatzung.
Dass Frieder die schwere Zeit gut überstanden hat, freut mich sehr. Solange das Haus so voll ist, wird sich Frieder nicht wohl fühlen. Ob es besser wird, wenn die richtige Besatzung kommt, wissen wir natürlich nicht. Armes Deutschland.
Euch allen die besten Wünsche und Grüße von
Eurer Frieda
Ich freue mich arg bis Gretel kommt.
Die Kinder gehen wieder in den Unterricht, die müssen sogar. Was tut denn mein guter Jörg?
Am 15. Mai schrieb meine Mutter an Tante Frieda folgenden Brief, den ein französischer Offizier überbrachte:
Haisterkirch, 15.5.45
Liebe Frieda!
Wir haben schon 2 Mal versucht, durch französische Offiziere, die durch Tübingen kamen, Dir Nachricht zu geben. Da sie nicht wussten, ob sie die Möglichkeit haben werden, die Briefe abzugeben, wissen wir nicht, ob diese Briefe Dich erreicht haben. Wir haben schwere Zeiten hinter uns, doch blieb der Hof unversehrt. Wir sind in großer Sorge um Dich und sehr froh, dass heute ein französischer Korporal so liebenswürdig ist, einen Brief an Dich mitzunehmen. Die Antwort auf unseren Brief wird er morgen früh wieder abholen. Bewirte ihn gut und gib ihm, wenn Du noch hast, von dem selbst gebrauten Schnaps 1/2 l. Schreib uns, wie es Dir und dem Hof geht. Ist Lothar Kaiser zur Arbeit gekommen? Sind Rosers noch da? Sind die Bilder unversehrt? Musstet Ihr viel Vieh abgeben? Ist die Obstbaumblüte erfroren? Wende Dich in allen Obstbausachen an Herrn Obstbauinspektor Kost. Hast Du Nachricht von den Stuttgarter Verwandten? Vielleicht kannst Du durch Doktor Thomä, der in Tübingen bei Hauptmann Böhm in der Fürbergstraße wohnt, durch einen Boten Nachricht holen lassen. Thomä kann Dir sicher sagen, wie es Fischers geht und ob die Firma weitere Zerstörungen erlitten hat.
Hast Du gehört, wie es der Familie Wizenmann geht? Vermittle an Frl. Margarete Kurz, Kielmeyerstr. 5 in Tübingen (am Wehr) bei Rottenmeyer die Nachricht, dass ihre Schwester Elfriede bei uns eine Stellung gefunden hat und dass es ihr gut geht.
Gretel hat versucht mit dem Korporal hinunter zu fahren, aber leider keine Erlaubnis erhalten. Sie kommt so bald wie möglich. Mach Dir inzwischen keine so großen Sorgen. Schone Dich und bleib gesund.
Grüße alle herzlich, auch Wenskes.
Wir grüßen Dich alle von Herzen.
Deine Paula
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann gib durch Thomä die Nachricht, dass wir und der Hof unversehrt sind, an das Sekretariat und an Dr. Fischer durch.
Auch Costia, ein Neffe meines Vaters, der einen Tag vor der Besatzung auf den Berghof kam, schrieb an meine Eltern:
Berghof, 9.5.45
Lieber Onkel! Liebe Tante!
Wir erhielten gestern Euren Brief von vorgestern, worüber wir uns sehr gefreut haben. Auch hier ist alles gesund. Seit 10 Tagen haben wir Einquartierung einer Sanitätskompanie, die die Feldpost Nr. Secteur SP 75385 (Tübingen Lustnau Berghof) hat. Frieda kocht für den Stab und hat sehr viel Arbeit. Der größte Teil des Hauses ist belegt, auch auf dem Hof. Das Vieh ist noch vorhanden (mit Ausnahme der meisten Hühner). Besondere Rücksicht wurde in Tübingen nicht genommen, da im Bebenhäuser Tal auch einige Schüsse fielen, wurde auch der Berghof mehrmals abgegrast. Die Panzer fahren z. Zeit am Hof vorüber.
Am allermeisten freut es uns, dass ihr zusammen mit Jörg gesund seid.
In der Sonnhalde ist trotz mehrfachem Eindringen auch alles wohlauf. KarlFink ist auf dem Hof.
Frieda weiß von ihren Angehörigen nichts, da Ulm von Amerikanern besetzt ist.
Einen Tag vor der Besetzung kam ich hierher. Unsere Mutter ist in der Nervenklinik, es geht ihr gut. Von meinem Bruder wissen wir nichts, er verließ Tübingen vorher.
Frieda hat auch einen Brief geschrieben, den wir versuchen mitzugeben.
Mit herzlichen Grüßen von Allen! Costia
Eines Nachmittags suchten wir nach den im Wald bei der Holzwiese vergrabenen zwei Kisten Wein. Wir waren lange erfolglos. Durch systematisches Stochern mit seinem Stock wurde mein Vater schließlich fündig.
Ein Brasilianer, der sich relativ frei bewegen durfte, agierte mit dem Fahrrad als Postbote. So konnte meine Mutter am 15.6. an Tante Frieda schreiben:
St. Georgshof, 15. 6. 1945
Liebe Frieda!
Gestern kamen Deine Briefe in unsere Hände, vom 19., 23. und 29. Mai. Wir waren ganz erschüttert, was Ihr durchmachen mußtet. Die arme Erna! Man könnte weinen, dass so viele unschuldige Menschen für anderer Vergehen büßen sollen. Vor dem Schlimmsten hat uns bis jetzt Frieder bewahren können. Ebenso waren Gretels Sprachkenntnisse eine große Hilfe. Ich wusste wohl, warum ich drunten bleiben wollte, willigte ja auch nur ein, als Frieder beschloß, bei Dir zu bleiben. Das Schicksal hat es anders gewollt, da Frieder hier erkrankte. Vielleicht hat es so sein sollen, dass Frieder bei seinem Kind blieb. Was aus uns geworden wäre, wenn er nicht hier gewesen wäre, weiß ich nicht. Es wäre uns wohl schlimm ergangen. Als wir noch mitten in der Gefahr standen (Jörg wäre beinah von einem Granatsplitter getroffen worden; die Granate schlug direkt beim Hof ein und zertrümmerte das äußere Atelierfenster) hörten wir, dass Tübingen tatsächlich kampflos übergeben wurde. Ich kann Dir nicht sagen, wie glücklich ich war, als ich das erfuhr. Damals hoffte ich, dass Du dort weniger gefährdet seiest als wir hier. Was aber dann noch kam, nun wissen wir es war und es ist noch nicht vorüber, weder hier noch dort. Was haben wir für Sorgen um Dich gehabt, als die Briefe nicht mehr durchkamen. Und was sorgen wir uns, da immer noch keine Nachricht von Gretel da ist. Am Montag schon hofften wir auf Nachricht. Und trotzdem hoffen wir, dass Du nun nimmer allein bist, dass Dir Gretel und O. beistehen kann. Mögt Ihr doch jetzt etwas mehr Ruhe haben! Wie hast Du gesundheitlich durchgehalten? Frl. Menzel schreibt, dass Du kollosal viel geleistet hast, hoffentlich nicht über die Kraft. Doch sobald Gretel da ist, mußt Du Dich schonen und pflegen. Und vielleicht kommt es bald einmal wieder, dass wir beisammen sein können. Heimweh hab ich eben doch und das Bedürfnis sich wieder auszusprechen, sich wiederzusehen, nach all dem Schweren, was wir durchgemacht haben und durchmachen!
Wenn Frieder hinauskommt und Du brauchst Gretel, so werde ich allein fertig. Elfriede, die sehr fleißig, tüchtig und angenehm ist im Umgang – es ist in der Not mir wieder die Richtige geschickt worden – will nach Tübingen zu ihrer Schwester, aber da Hedwig ja nur noch drei Zimmer zu richten hätte, müßte es auch gehen. Die große Wäsche ging ganz glatt vorüber, obwohl die eigene Waschmaschine kaputt ist. Aber wie gut haben wir draußen mit unserer Einrichtung zu arbeiten gegen hier! Aber es muß auch gehen. Nun sagt Frieder, ich dürfe nicht allein bleiben hier. Aber nochmals: ich bin zu allem bereit. Sollte Frieder m. Auto geholt werden, was ich immer hoffe, dass O. einen Passierschein für F[rieder]. erhält, dann kann Gretel ja mit heraufkommen, falls die Verhältnisse hier sich weiter verschlimmern, sodass ich tatsächlich nicht allein hier bleiben könnte. Ev. kann sie ja wieder mit hinunterfahren, wenn es d. hiesigen Verhältnisse erlauben. Doch Du warst nun so lange allein, nun mache ich es auch einmal. Wie froh war ich, dass Du schriebst, Du seiest immer achtungsvoll behandelt worden.
Nun leb wohl, liebe Frieda. Hab Dank für alles, was Du für uns und den schönen Berghof getan und gelitten hast.
Grüße alle!
Deine Paula
Anfang Juni bekam meine Tante Gretel einen Passierschein, um auf den Berghof zu fahren. Tante Frieda hatte Unterstützung dringend nötig. Ende Juni erhielt mein Vater einen Passierschein und konnte damit auch nach Tübingen fahren. Er fand dort alles in guter Verfassung, und insbesondere Tante Frieda, wohlbehalten vor. Der nächste Brief stammt vom 28. Juli.
Haisterkirch, 28. Juli 1945
Liebe Frieda!
Nun habe ich Nachricht von Lotte*). Der Brief liegt bei. Gott sei Dank immer noch besser, als ich zu hoffen wagte, es ist ihr doch kein Leid geschehen. Hoffentlich darf ihr Mann bald nach Hause. Es kommen immer wieder welche, so Wolfgang Knöpfler gestern.
Ich habe eine Menge Arbeit. Hedwig geht morgen für einige Tage. Die Haushaltstochter ist seit gestern da. Bertas Vater sagte, sie könne nur für einige Tage weg. Er braucht seine Tochter. Waschen, Einmachen, Gartenarbeit, Kochen. Gott sei Dank, mein Fuß ist ordentlich. Hatte große Sehnsucht nach der Waschküche v. Berghof. Hier ist‘s eine Schinderei. Maschine wieder kaputt. Eingemacht habe ich 31 Gläser Kompott, 15 Marmelade und 30 Flaschen Johannisbeersaft. Hatte keinen Zucker. Mußte eben Gelee draus machen.
Gretel schreibt, sie habe eine Art Grippe. Hoffentlich geht ihr’s wieder gut. Man hat eben viel zu viel an sich hängen. Schade, dass Julie auch krank ist, wir hätten uns so sehr über ihr Kommen gefreut. Das Abgespanntsein von allen in dieser Zeit ist schwer. Ich helfe mir durch die viele Arbeit drüber weg. Ich freu mich so über Euren Brief, der am Mittwoch kam. Vielen Dank. Wie geht es Frieder? Hoffentlich ist er jetzt ruhiger, seit dem er bei Euch ist. Der Arme hat sich fürchterlich gesorgt. Wenn nur der Schlaf wieder besser wird. Lotte* schicke ich Lebensmittel bei nächster Gelegenheit. Es kommt in nächster Zeit jemand nach Kreßbronn. Was macht Dein Arm? Hoffentlich erholst Du Dich.
Und nun leb wohl. Vielleicht sind wir doch bald wieder beieinander.
Mit vielen herzlichen Grüßen von uns allen.
Deine Paula
*) Nichte von Tante Frieda in Kreßbronn
Den ganzen Sommer arbeitete ich auf dem Hof. Ich wollte damals noch Landwirtschaft studieren, dies im Hinblick auf Pflanzenzüchtung. Ich molk täglich morgens und abends bis zu 14 Kühe. Ich hatte Latein- und Griechisch-Unterricht bei unserem Nachbarn, Herrn Oberlehrer Knöpfler.
Im letzten Haus von Haisterkirch Richtung Osterhofen wohnte ein Ingenieur Fiedler. Vom deutschen Raketenbauzentrum in Peenemünde hatte es ihn nach Haisterkirch verschlagen. Eines Nachts wurden die Fiedlers überfallen, wobei Herr Fiedler verletzt wurde. Kurze Zeit später holten ihn die Amerikanern nach Cape Canaveral, dem amerikanischen Raketenzentrum.
In den folgenden Tagen ging das Gerücht um, die nächsten, die überfallen würden, seien wir. Wir holten daher vom Hof die drei großen Kuhglocken und deponierten sie auf dem Dachboden. Im Ernstfall wollten wir damit so großen Lärm machen, dass es den Räubern vergehen sollte. Passiert ist jedoch nichts. Der nächste Brief stammt vom 5. September:
St. Georgshof, 5. 9. 1945
Liebe Frieda!
Nun mußt auch Du noch einige Worte direkt bekommen. Gretel liest Dir ja meine Briefe vor. Ich habe immer so viel zu tun, da geht es rascher mit Stenographieren.
Hast Du Dich in Deinem Urlaub etwas*) erholt? Ich habe zwar noch immer alle Hände voll zu tun, aber das schwere Heben bei der Wäsche und die ganz grobe Arbeit nimmt mir Bertha doch ab. So erhole ich mich auch.
Jörg ist selig mit seinem Geist (Schwester Bertha). Er sieht sehr viel besser aus. Die Obsternte tut ihm nun so gut. Er ist wieder sehr fleißig auch hier. Dann habe ich mir einen Ersatz für Lore Federolf zugelegt, eine sehr brave Elisabeth, Tochter v. Dr. Walther. Sie ist recht brauchbar. Ich bringe sie natürlich mit, da sie eine regelrechte Lehre durchmacht, also bei mir bleiben muß. Gretel hat ja ein junges Mädel engagiert. Hoffentlich ist sie brauchbar. Ich wundere mich, dass sie so ein junges Ding genommen hat. Doch der Haushalt ist ja klein beieinander, wenn Jörg und ich weg sind.
Einmacherei gibt es ja keine mehr nachher, und auch der Garten macht nimmer die Arbeit, wie im Sommer. Mit weniger Leuten geht’s allemal viel leichter. Wenn auch die Viertelskraft von Hedwig zuletzt, als sie so Heimweh hatte, doch zuwenig war zu Gartenarbeit, Einmachen und großer Wäsche neben dem Haushalt.
Nun werden wir uns bald wieder sehen, will’s Gott. Es war eine schwere, ereignisreiche Zeit. Doch wir wollen nicht klagen, da wir alle noch leben. Hier habe ich mich so eingelebt, dass mir andererseits das Weggehen schwer fällt. Ich muss mich auf dem Berghof wohl zuerst an die Zerstörungen gewöhnen. Andererseits kommt Bertha mit ihrer Nähmaschine und will putzen, nähen, flicken und die Kleider aufdämpfen. Das macht sie tadellos. Du siehst, ich komme mit Hilfen, die sich sehen lassen können. Bertha sagt, sie sei das ‘auf der Bühne schlafen’ in letzter Zeit gewöhnt worden in Göppingen. Der deutsche Mensch muss sich in alles finden, sein Schicksal zu tragen. Glücklich dem, der es wie Bertha mit Humor meistert. Das ist ein frohes Lachen den ganzen Tag. Übrigens Bertha kommt nicht gleich mit. Nicht, dass Du meinst, Du müßtest für sie richten. Vielleicht kann sie kommen, wenn Du einige Zeit Ferien nimmst.
Hier ist es nun sehr ruhig geworden. Die Franzosen sind sehr streng gegen die Plünderer vorgegangen. Die Anführer der Banden, die uns bedrohten, sind gefangen. Die Kuhglocken bleiben von jetzt an hoffentlich eine Dekoration. Ich hoffe, dass Otto Fischer die Ruhe, die nun hier herrscht, genießen wird. Ich will ihn recht herausfüttern. Mutter bekommt unsere gute Küche recht. Sie sieht entschieden besser aus und will auch wieder unter die Leute gehen. Alles in allem ist dies ein schöner Fortschritt. Seit 8 Tagen nimmt sie keine Schlafmittel mehr. Aber der Bruch plagt sie sehr.
Ich bin begierig, was Du von Deiner lieben Mutter berichtest und von Deinen Verwandten. Ich will sehen, dass ich von Lotte in nächster Zeit noch Nachricht erhalte.
Nun wirst Du unsere nächsten Nachrichten von Frieder bekommen.
Ich hoffe, dass sich Andres gut einlebt. Mußt ein bisschen nach ihm sehen.
Jörg ist gut Freund mit ihm.
Nun leb wohl! Grüße alle herzlichst!
Von uns allen die besten Grüße
Deine Paula
*) An dieser Sau ist Jörg schuld. **) [„Sau“ bedeutet hier „Tintenklecks“.]
**) typisch (Anm. d. Verf.)
Ende Oktober siedelten wir nach Tübingen über. Das Land war noch unter strenger Kontrolle des französischen Militärs. An den zahlreichen Straßensperren, so z.B. in Dürmendingen, wurden wir und unser Auto genau kontrolliert. Im November begann die Schule wieder. Der Unterricht fand im Zeichensaal statt. Wir waren damals schon eine gemischte Schule, da die Professoren ihre Töchter auch aufs Gymnasium schicken wollten. Ich saß neben einem sehr netten blonden Mädchen, Silvia Wais, der Tochter des Landeskonservators. Sie nannte mich immer Zundele, was sich recht verliebt anhörte.
Unsere Lehrer versuchten, das verlorene Schuljahr aufzuholen. Dadurch gab es schrecklichen Schulstress. 16 von 22 Schülern wiederholten das verlorene Jahr. Auch mir blieb dies nicht erspart. In der neuen Klasse saß ich neben Rainer Hähnle, mit dem ich seither befreundet bin. Er studierte später in Tübingen Chemie und arbeitete anschließend bei der Firma Hoechst. Er wohnt in Hofheim im Taunus mit Blick auf seinen früheren Brötchengeber.
Alle unsere Autos waren bei Kriegsende von den Franzosen requiriert worden. Daher ließ sich mein Vater ein kleines Auto, einen Opel Kadett, zusammenbasteln. Mit diesem fuhren wir mehrmals nach Haisterkirch, um dort nach dem Rechten zu sehen. Das hierzu notwendige Benzin beschaffte sich mein Vater auf dem schwarzen Markt beim Altwarenhändler Möck. Einmal mussten wir nach Haisterkirch, da die Franzosen als Reparationsleistung Vieh requirieren wollten. Alle Tiere mussten im Freien angebunden werden. Die Franzosen waren von unserer Herde sehr beeindruckt. Sie wählten sich die besten Kühe aus. Auf der Höhe über Haisterkirch wurden große Waldbestände als Reparationsleistungen geschlägert.
In Tübingen wohnten wir damals in und über dem Atelier, denn im Wohnhaus war Colonel Roulies mit seiner Familie einquartiert. Er war die rechte Hand des französischen Gouverneurs Wiedmer von Südwürttemberg. Das Verhältnis zu Colonel Roulies und zu seiner Familie war sehr gut. Meine Großmutter durfte sogar in ihrem Zimmer inmitten der Familie Roulies bleiben. Meine Großmutter und die Roulies’sche Großmutter strickten zusammen im Garten und verständigten sich mit Mühe, aber nicht ohne Erfolg. Mit seinem Sohn wollte ich mich anfreunden, jedoch hatten wir keine gemeinsamen Interessen. Einmal wurde ich von der Familie Roulies zum Mittagessen eingeladen. Für mich war dies eine echte Orgie, denn es wurde mir viel Wein und auch ein Schnaps eingeflößt. Herr Roulies meinte nachher entschuldigend zu meiner Mutter: „Der eine Schnaps ist doch kein Alkohol.” Ich habe diese Einladung jedenfalls gut überstanden. Die hübsche Tochter Geniève von Colonel Roulies verunglückte kurze Zeit später bei einem Verkehrsunfall in Südfrankreich tödlich.
Herr Roulies, ein Verwaltungsfachmann, musste leider bald nach Frankreich zurückkehren, um eine Präfektur im Departement Frejus zu übernehmen. Als dort der katastrophale Dammbruch passierte, spendeten wir Geld, wofür sich Herr Roulies sehr herzlich bedankte. Er besuchte uns auch öfters – seine Zeit in Tübingen hatte er offenbar in bester Erinnerung.
Sein Nachfolger war ein arroganter Berufsoffizier, angeblich ein Herzog. Insbesondere seine Kinder brachten es in kurzer Zeit fertig, unser Haus so zu demolieren, dass den Beamten vom Amt für Besatzungsschäden die Haare senkrecht zu Berge standen. Das Geschirr, insbesondere das Besteck, sah aus als ob es von Vandalen benutzt worden wäre. Kein Messer war mehr im Heft. Durch eine dicke Wand zwischen zwei Zimmern im ersten Stock hatten die Kinder ein Loch geschlagen.
Im Herbst gab es auf dem Berghof sehr viel Steinobst. Wir verkauften es in der Milchküche. Dort wartete am späten Nachmittag eine lange Menschenschlange. Mein Vater achtete darauf, dass das Steinobst so verteilt wurde, dass jeder etwas von der täglichen Ernte bekam. Man kann es sich heute nicht vorstellen, dass die Hungersnot so groß war, dass täglich dutzende Leute von Tübingen auf den Berghof wanderten, dies bloß wegen eines Pfundes Steinobst. |

